Hallo Nightvision,
das Thema, welches Du ansprichst muß in mehre Punkte unterteilt werden, da die Ansaugwege alleine nicht für Drehzahl und Drehmoment verantwortlich sind.
Die Erklärung von Thomas hat schon einen wichtigen teil angesprochen, den
Gaswechsel, auf welchen ich noch einmal eingehen möchte.
Alle Erklärungen richten sich momentan auf Motoren mit Zündkerzenzündung, welche ein zündfähiges Gemisch „ansaugen“ i.e. damit befüllt werden, also das, was als „Saugmotor“ bezeichnet wird. In wieweit die Gemischbildung hier nun über Vergaser- oder Einspritzung erfolgt lasse ich ebenso wie das Abgas außer Acht.
Beginnen möchte ich jedoch mit der Erklärung des Drehmoments i.e. der Motorleistung.
Grundsätzlich ist die Motorleistung {kw/PS} ein Produkt aus Drehmoment und Drehzahl.
Das
Drehmoment ist die Kraft {F}, mit welcher sich der Verbrennungsdruck auf die Pleuelstange auswirkt und schließlich die Kurbelwelle in Drehbewegung versetzt. Die Maßeinheit für diese Kraft ist Newton {N}. Für die Größenzahl des auf diese Weise erzeugten Drehmoments ist die
Länge des Hebelarmes {L}, gemessen in Metern, zwischen der Kurbelwellenachse und dem Kurbelzapfen entscheidend. Grob gesagt entspricht diese Zahl dem
„Hub" des Motors. Das Drehmoment {M} selbst ist also ein Produkt aus der ausgeübten Kraft und der Länge dieses Hebelarmes, daher wird die Maßeinheit
Newtonmeter genannt.
Wie wir sehen, stellt der Verbrennungsdruck auf den Kolben einen entschiedenen Faktor dar. Nun greife ich auf die schon gegeben Erklärung der Luftsäulen zurück. Wie beschrieben ist ein Kolbenmotor eine periodisch arbeitende Maschine, welche über Luft Ein- und Auslässe – ich bleibe hier beim Viertaktmotor – also über Ventile gesteuert wird.
Für ein gutes Ansprechverhalten – Drehmoment – im unteren Drehzahlbereich, d.h. beim anfahren und „normalem“ fahren ist nun eine „lange“ Luftsäule und kleiner Einlassventildurchmesser/Ventilhubhöhe sehr vorteilhaft, nötig. Aus diesem Grund waren bis etwa Mitte der 80iger Jahre der Großteil der PKW Motoren nach diesem System aufgebaut. Erst die voranschreitende Motorelektronik ermöglichte Kompromisslösungen, welche die Problematik lösen konnten.
Hier bot sich einmal der variable Ventilhub an, welcher über eine verstellbare, d.h. Drehzahlabhängig gesteuerte Einlassnockenwelle gesteuert wird. Dieses System bietet jedoch keine Veränderung der anliegenden Luftsäulen. Daimler Benz führte die verstellbare Einlassnockenwelle mit dem M 104 ein, welcher jedoch immer als Durchzugsschwach gegenüber seinem „Halbbruder“ M 103 galt. Erst bei hohen Drehzahlen, war er Aufgrund seines bessern „Luftwechsels“ agiler.
Da mit dem Wechsel der Doppelnockenwellenmotoren der Baureihen M 104/M 119 auf die Motoren der Baureihen M 112/113 die Einlaß- und Auslassnockenwelle wegfiel und die Motoren nur noch eine Nockenwelle je Zylinderbank aufweisen, wurde die Länge der „Luftsäule“ und damit der optimale Drehmomentverlauf durch verstellbare Saugrohre verändert. Hierbei verschieben sich über Unterdruck gesteuerte Klappen im „V“ der Motoren und verkürzen ab einer Drehzahl von 3.500 - 3.700 U7min die Länge der Saugrohre, d.h. es wird von „langen“ auf „kurze“ Saugrohre umgeschaltet.
Wichtig ist hierbei immer der optimale Lastwechsel des Motors, weswegen bei zunehmender Motordrehzahl die Ansaugrohre immer kürzer werden.
Da in dem Drehmoment jedoch auch die Hublänge ein Faktor darstellt, bekommen die Motorenhersteller das Problem mit der Kolbengeschwindigkeit. Bei hohen Kolbengeschwindigkeiten ist der Verschleiß {Kolbenringe/Kolbenlaufbahnen} als auch die Belastung des Motoröles ungleich höher, weswegen hier der Hub reduzier wird: Wir müssen also das Verhältnis Bohrung/Hub beachten und wie der Motor ausgelegt ist. Hier möchte ich als Beispiel einmal 3 Saugmotoren der 3.2 Liter Klasse aufführen:
Ich beginne mit dem aktuellen und bekannten M 112.949 {M 112 E 32}
E 320.
Hier handelt es sich um einen V 6-90° mit 3 Ventilen je Zylinder und variablen Ansaugrohren.
Bohrung: 89.9 mm; Hub: 84.0 mm; Hubraum 3.199 cm³; Verdichtung: 10.0:1
Bei 5.600 U/min leistet dieser Motor 224 PS und bietet ein maximales Drehmoment von 315 Nm bei 3.000 U/min. Die Kolbengeschwindigkeit bei Nennleistungsdrehzahl beträgt 15.68 m/s.
Nun der
M 103.980 3.2
http://mitglied.lycos.de/oschneider/M103980_32.jpg
Hier handelt es sich um einen „Tuner-Motor“ auf Basis des bekannten „300 E“.
Ein Reihensechszylinder mit vergrößerten Lufteinlässen, polierten Ein- und Auslasskanälen, vergrößerter Ventilhub, jedoch „starrer“ Motorgeometrie.
Bohrung: 90.0 mm; Hub: 84.0 mm; Hubraum 3.205 cm³; Verdichtung: 10.0:1
Bei 5.750 U/min leistet dieser Motor 245 PS und bietet ein maximales Drehmoment von 324 Nm, allerdings erst bei 4.500 U/min. Die Kolbengeschwindigkeit bei Nennleistungsdrehzahl beträgt 16.10 m/s.
Der
F 105 C
http://mitglied.lycos.de/oschneider/F105C.jpg
Hier handelt es sich um einen hochdrehenden auf Leistung ausgelegten Motor in starrem mechanischen Aufbau. Um die bewegten masse je Zylindereinheit klein zu halten ist er in 8 Zylinder V-90° Bauart ausgelegt.
Bohrung: 83.0 mm; Hub: 73.6 mm; Hubraum 3.185 cm³; Verdichtung: 9.8:1
Bei 7.000 U/min leistet dieser Motor 270 PS und bietet ein maximales Drehmoment von 304 Nm bei 5.500 U/min. Die Kolbengeschwindigkeit bei Nennleistungsdrehzahl beträgt 17,17 m/s.
Anhand dieses Beispiels erkennen wir schon das verschieben des Drehmomentes und der Nennleistung zu höheren Drehzahlen mit zunehmender Veränderung des Motoraufbaues in Bezug auf Luftzufuhr und Abgasabführung.
Anzumerken bliebe noch die Lösung, die Saugrohre elektrisch verstellbar zu gestalten:
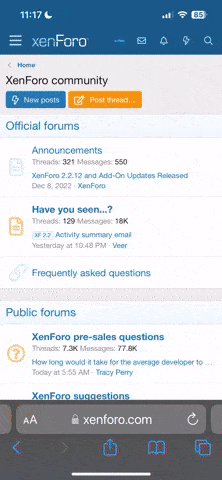
 .
. da tut sich ja doch was
da tut sich ja doch was