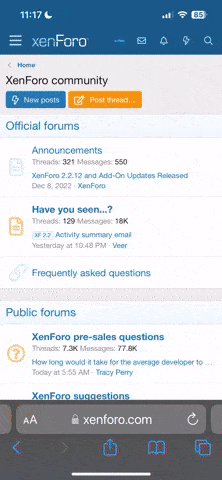Mercedesfahrer
Crack
- Beiträge
- 1.604
- Fahrzeug
HYBRIDFAHRZEUGE - Antrieb für die Zukunft
Mit der M-Klasse HYPER hat die DaimlerChrysler-Forschung ein neuartiges Hybridfahrzeug vorgestellt, das bis zu 20 Prozent weniger Kraftstoff verbraucht als das vergleichbare Serienmodell. In den Antriebsstrang des sportlichen Allradfahrzeugs sind eine spezielle Kupplung und ein Elektromotor integriert. Damit kann man auf Lichtmaschine und Anlasser verzichten, was Gewicht und Kosten spart.
Stuttgart, 01.12.2003
Hybrida, so steht’s im lateinischen Wörterbuch, bedeutet Mischling. In der Autoindustrie definieren Ingenieure ein Hybridfahrzeug als ein Automobil, das zwei Energiewandler hat, zum Beispiel einen Verbrennungs- und einen Elektromotor – und deshalb auch zwei Energiespeicher braucht, in diesem Fall einen Kraftstofftank und eine Hochvoltbatterie.
Doch wer bei der M-Klasse HYPER, einem der jüngsten Hybridfahrzeuge der DaimlerChrysler-Forschung, unter die Motorhaube schaut, wird den Geländewagen auf den ersten Blick kaum als Hybriden erkennen. Zwar ist das serienmäßige 2,7-Liter-CDI-Dieselaggregat nicht zu übersehen, doch ein herkömmlicher Elektromotor und die dazugehörige Batterie sind nicht auszumachen.
Die Gründe dafür erläutert Prof. Karl E. Noreikat, Leiter der Abteilung Alternative Antriebssysteme: „Wir haben bereits einen hohen Integrationsgrad der beiden Antriebsaggregate erreicht. Der Elektromotor wird immer stärker in den Antriebsstrang integriert und benötigt mittlerweile kaum noch zusätzlichen Bauraum. Er sitzt direkt auf der Getriebeeingangswelle – also zwischen der Kupplung und dem Getriebe, mit dem er eine räumliche Einheit bildet.“
Vom Zylinder zur Scheibe
Möglich wurde diese Integration durch ein neues Design des Elektromotors. Dieser hat nämlich keinen lang gestreckten, zylinderförmigen Läufer wie ein herkömmlicher E-Motor, der etwa in einer Bohrmaschine steckt. Stattdessen besitzt das neuartige Elektroaggregat einen ringförmigen Rotor, der einen vergleichsweise großen Durchmesser hat, dafür aber sehr schmal ist. Noreikat und sein Team sprechen deshalb auch vom „Sausage-“ und vom „Disc-Motor“.
Der drehmomentstarke „Disc-Motor“ mit einer Leistung von 45 kW hat freilich nicht nur den Vorzug, sich gut in den bestehenden Antriebsstrang einzufügen. Dank seiner ausgeklügelten Steuerungselektronik und der technisch sehr anspruchsvollen Kupplung bietet er noch weitere Vorteile:
So dient er auch als Starter und Generator. Damit braucht das Fahrzeug keine Lichtmaschine und keinen Anlasser mehr, und dies bedeutet neben einer Gewichtsersparnis auch eine Vereinfachung des gesamten Antriebsstrangs und der Verkabelung.
Zudem erlaubt er den Verzicht auf einen zweiten Elektromotor, der bei den schon auf dem Markt erhältlichen Hybridfahrzeugen bisher meist üblich ist. Ein zweiter Motor bedeutet aber mehr Gewicht, mehr Kosten und mehr Platzbedarf.
Schließlich ist die Rekuperationsleistung, also die pro Zeiteinheit aus der Bewegungsenergie zurück gewonnene elektrische Energie, doppelt so hoch wie bei den bisher verwirklichten Hybridkonzepten. Nicht zuletzt deshalb verbraucht die M-Klasse HYPER im „Neuen Europäischen Fahrzyklus“ gegenüber dem vergleichbaren Mercedes-Benz-Serienfahrzeug ML 270 CDI bis zu 20 Prozent weniger Kraftstoff.
Einen weiteren Pluspunkt nennt Prof. Herbert Kohler, Leiter der Forschungsdirektion Fahrzeugaufbau und Antriebe: „Trotz ihres verringerten Kraftstoffverbrauchs bieten alle unsere Hybridfahrzeuge gegenüber vergleichbaren konventionellen Fahrzeugen eine deutlich bessere Fahrdynamik.“ Der Grund: E-Motoren entwickeln beim Anlaufen sofort ihr maximales Drehmoment und erlauben deshalb ein sehr zügiges Anfahren.
Zudem können sie während der Fahrt den Verbrennungsmotor durch ein zusätzliches Drehmoment unterstützen und sorgen dadurch für eine verbesserte Beschleunigung. Die M-Klasse HYPER beschleunigt auf diese Weise mit ihrem 120 kW starken 5-Zylinder-Reihenmotor so gut wie eine M-Klasse mit der nächst größeren Motorisierung.
Bewährtes neu kombiniert
Weniger Verbrauch und Emissionen, bessere Fahrdynamik und gute Integration in den Antriebsstrang – die Pluspunkte der M-Klasse HYPER beruhen nicht zuletzt darauf, dass Noreikats Team nach einer einfachen und kompakten Lösung gesucht hat. „Wir wollten bewährte Teile geschickt neu kombinieren, um so zu zuverlässigen und kostengünstigen Lösungen zu kommen“, erläutert Noreikat.
Durch ein einfaches „Parallelhybridkonzept“ ist es den Ingenieuren gelungen, die Trümpfe der Hybridtechnologie auszuspielen und dabei alle Komfort- und Leistungsmerkmale des konventionellen Antriebsstrangs zu erhalten oder sogar zu verbessern. „Von Vorteil ist hier auch, dass wir für die Montage des Hybridsystems das Verteilergetriebe des permanenten Allradantriebs nicht modifizieren mussten“, erläutert Noreikats Mitarbeiter Christof Bunz.
Viel Mühe und Zeit haben Bunz und seine Kollegen in die Entwicklung der elektronisch gesteuerten Kupplungseinheit gesteckt, die das sich ständig ändernde Zusammenspiel zwischen Verbrennungs- und Elektromotor sowie dem automatisch betätigten 6-Gang-Schaltgetriebe regelt. Der Clou dabei ist: Die Kupplung gleicht die unterschiedlichen Drehzahlen und -momente beider Motoren und des Getriebes so sanft aus, dass ein kontinuierliches und ruckfreies Fahren gewährleistet ist. Beim Beschleunigen spürt der Fahrer deshalb nur wenig von den Schaltvorgängen.
Was die clevere Kupplung alles kann, zeigt sich deutlich beim näheren Betrachten der verschiedenen Betriebszustände:
Beim Anfahren und bei geringen Geschwindigkeiten im Stadtverkehr oder bei Staus ist der Dieselmotor ganz abgeschaltet; nur der Elektromotor bewegt das Fahrzeug vorwärts. Je nach Betriebszustand sorgt ab etwa 25 km/h die Kupplung dafür, dass der Verbrennungsmotor angeschleppt und gestartet wird.
Im konventionellen Fahrbetrieb treibt der Verbrennungsmotor das Auto an. „Der E-Motor“, so Bunz, „wird in dieser Betriebsart nur benutzt, um das Getriebe bei Schaltvorgängen zu synchronisieren.“
Beim Beschleunigen, etwa zum Überholen, schaltet sich der Elektromotor automatisch zu, so dass sich die Drehmomente beider Motoren addieren. Die Ingenieure sprechen hier von einer „Booster-Funktion“.
Bei längeren Bremsvorgängen schaltet der Dieselmotor ab und der E-Motor dient zur Rekuperation: Er wird von den Rädern über das Getriebe angetrieben und funktioniert nun als Generator, indem er Bewegungsenergie in elektrische Energie umwandelt, die in die Batterie eingespeist wird.
Aufgeladen wird die Batterie auch bei konstanter Fahrt auf der Autobahn oder Landstraße, wenn der Verbrennungsmotor keine volle Leistung bringen muss. In diesem Zustand schleppt dann nicht das Getriebe, sondern der Dieselmotor den Elektromotor mit und macht ihn zum Stromerzeuger, der die Batterie auflädt.
Batterie mit Wasserkühlung
Apropos Batterie: Bei ihr handelt es sich um eine wassergekühlte, 50 kW leistende Nickel-Metallhydrid-Batterie, die zusammen mit der elektronischen Batteriesteuerung Platz sparend in der Ersatzradmulde im Heck des Fahrzeugs untergebracht ist. Und damit löst sich dann auch das Rätsel um den zweiten Energiespeicher, der unter der Motorhaube nicht zu entdecken ist.
Ein Bild dazu ist hier:
http://www.db-forum.de/showthread.php?s=&postid=88351#post88351
Mit der M-Klasse HYPER hat die DaimlerChrysler-Forschung ein neuartiges Hybridfahrzeug vorgestellt, das bis zu 20 Prozent weniger Kraftstoff verbraucht als das vergleichbare Serienmodell. In den Antriebsstrang des sportlichen Allradfahrzeugs sind eine spezielle Kupplung und ein Elektromotor integriert. Damit kann man auf Lichtmaschine und Anlasser verzichten, was Gewicht und Kosten spart.
Stuttgart, 01.12.2003
Hybrida, so steht’s im lateinischen Wörterbuch, bedeutet Mischling. In der Autoindustrie definieren Ingenieure ein Hybridfahrzeug als ein Automobil, das zwei Energiewandler hat, zum Beispiel einen Verbrennungs- und einen Elektromotor – und deshalb auch zwei Energiespeicher braucht, in diesem Fall einen Kraftstofftank und eine Hochvoltbatterie.
Doch wer bei der M-Klasse HYPER, einem der jüngsten Hybridfahrzeuge der DaimlerChrysler-Forschung, unter die Motorhaube schaut, wird den Geländewagen auf den ersten Blick kaum als Hybriden erkennen. Zwar ist das serienmäßige 2,7-Liter-CDI-Dieselaggregat nicht zu übersehen, doch ein herkömmlicher Elektromotor und die dazugehörige Batterie sind nicht auszumachen.
Die Gründe dafür erläutert Prof. Karl E. Noreikat, Leiter der Abteilung Alternative Antriebssysteme: „Wir haben bereits einen hohen Integrationsgrad der beiden Antriebsaggregate erreicht. Der Elektromotor wird immer stärker in den Antriebsstrang integriert und benötigt mittlerweile kaum noch zusätzlichen Bauraum. Er sitzt direkt auf der Getriebeeingangswelle – also zwischen der Kupplung und dem Getriebe, mit dem er eine räumliche Einheit bildet.“
Vom Zylinder zur Scheibe
Möglich wurde diese Integration durch ein neues Design des Elektromotors. Dieser hat nämlich keinen lang gestreckten, zylinderförmigen Läufer wie ein herkömmlicher E-Motor, der etwa in einer Bohrmaschine steckt. Stattdessen besitzt das neuartige Elektroaggregat einen ringförmigen Rotor, der einen vergleichsweise großen Durchmesser hat, dafür aber sehr schmal ist. Noreikat und sein Team sprechen deshalb auch vom „Sausage-“ und vom „Disc-Motor“.
Der drehmomentstarke „Disc-Motor“ mit einer Leistung von 45 kW hat freilich nicht nur den Vorzug, sich gut in den bestehenden Antriebsstrang einzufügen. Dank seiner ausgeklügelten Steuerungselektronik und der technisch sehr anspruchsvollen Kupplung bietet er noch weitere Vorteile:
So dient er auch als Starter und Generator. Damit braucht das Fahrzeug keine Lichtmaschine und keinen Anlasser mehr, und dies bedeutet neben einer Gewichtsersparnis auch eine Vereinfachung des gesamten Antriebsstrangs und der Verkabelung.
Zudem erlaubt er den Verzicht auf einen zweiten Elektromotor, der bei den schon auf dem Markt erhältlichen Hybridfahrzeugen bisher meist üblich ist. Ein zweiter Motor bedeutet aber mehr Gewicht, mehr Kosten und mehr Platzbedarf.
Schließlich ist die Rekuperationsleistung, also die pro Zeiteinheit aus der Bewegungsenergie zurück gewonnene elektrische Energie, doppelt so hoch wie bei den bisher verwirklichten Hybridkonzepten. Nicht zuletzt deshalb verbraucht die M-Klasse HYPER im „Neuen Europäischen Fahrzyklus“ gegenüber dem vergleichbaren Mercedes-Benz-Serienfahrzeug ML 270 CDI bis zu 20 Prozent weniger Kraftstoff.
Einen weiteren Pluspunkt nennt Prof. Herbert Kohler, Leiter der Forschungsdirektion Fahrzeugaufbau und Antriebe: „Trotz ihres verringerten Kraftstoffverbrauchs bieten alle unsere Hybridfahrzeuge gegenüber vergleichbaren konventionellen Fahrzeugen eine deutlich bessere Fahrdynamik.“ Der Grund: E-Motoren entwickeln beim Anlaufen sofort ihr maximales Drehmoment und erlauben deshalb ein sehr zügiges Anfahren.
Zudem können sie während der Fahrt den Verbrennungsmotor durch ein zusätzliches Drehmoment unterstützen und sorgen dadurch für eine verbesserte Beschleunigung. Die M-Klasse HYPER beschleunigt auf diese Weise mit ihrem 120 kW starken 5-Zylinder-Reihenmotor so gut wie eine M-Klasse mit der nächst größeren Motorisierung.
Bewährtes neu kombiniert
Weniger Verbrauch und Emissionen, bessere Fahrdynamik und gute Integration in den Antriebsstrang – die Pluspunkte der M-Klasse HYPER beruhen nicht zuletzt darauf, dass Noreikats Team nach einer einfachen und kompakten Lösung gesucht hat. „Wir wollten bewährte Teile geschickt neu kombinieren, um so zu zuverlässigen und kostengünstigen Lösungen zu kommen“, erläutert Noreikat.
Durch ein einfaches „Parallelhybridkonzept“ ist es den Ingenieuren gelungen, die Trümpfe der Hybridtechnologie auszuspielen und dabei alle Komfort- und Leistungsmerkmale des konventionellen Antriebsstrangs zu erhalten oder sogar zu verbessern. „Von Vorteil ist hier auch, dass wir für die Montage des Hybridsystems das Verteilergetriebe des permanenten Allradantriebs nicht modifizieren mussten“, erläutert Noreikats Mitarbeiter Christof Bunz.
Viel Mühe und Zeit haben Bunz und seine Kollegen in die Entwicklung der elektronisch gesteuerten Kupplungseinheit gesteckt, die das sich ständig ändernde Zusammenspiel zwischen Verbrennungs- und Elektromotor sowie dem automatisch betätigten 6-Gang-Schaltgetriebe regelt. Der Clou dabei ist: Die Kupplung gleicht die unterschiedlichen Drehzahlen und -momente beider Motoren und des Getriebes so sanft aus, dass ein kontinuierliches und ruckfreies Fahren gewährleistet ist. Beim Beschleunigen spürt der Fahrer deshalb nur wenig von den Schaltvorgängen.
Was die clevere Kupplung alles kann, zeigt sich deutlich beim näheren Betrachten der verschiedenen Betriebszustände:
Beim Anfahren und bei geringen Geschwindigkeiten im Stadtverkehr oder bei Staus ist der Dieselmotor ganz abgeschaltet; nur der Elektromotor bewegt das Fahrzeug vorwärts. Je nach Betriebszustand sorgt ab etwa 25 km/h die Kupplung dafür, dass der Verbrennungsmotor angeschleppt und gestartet wird.
Im konventionellen Fahrbetrieb treibt der Verbrennungsmotor das Auto an. „Der E-Motor“, so Bunz, „wird in dieser Betriebsart nur benutzt, um das Getriebe bei Schaltvorgängen zu synchronisieren.“
Beim Beschleunigen, etwa zum Überholen, schaltet sich der Elektromotor automatisch zu, so dass sich die Drehmomente beider Motoren addieren. Die Ingenieure sprechen hier von einer „Booster-Funktion“.
Bei längeren Bremsvorgängen schaltet der Dieselmotor ab und der E-Motor dient zur Rekuperation: Er wird von den Rädern über das Getriebe angetrieben und funktioniert nun als Generator, indem er Bewegungsenergie in elektrische Energie umwandelt, die in die Batterie eingespeist wird.
Aufgeladen wird die Batterie auch bei konstanter Fahrt auf der Autobahn oder Landstraße, wenn der Verbrennungsmotor keine volle Leistung bringen muss. In diesem Zustand schleppt dann nicht das Getriebe, sondern der Dieselmotor den Elektromotor mit und macht ihn zum Stromerzeuger, der die Batterie auflädt.
Batterie mit Wasserkühlung
Apropos Batterie: Bei ihr handelt es sich um eine wassergekühlte, 50 kW leistende Nickel-Metallhydrid-Batterie, die zusammen mit der elektronischen Batteriesteuerung Platz sparend in der Ersatzradmulde im Heck des Fahrzeugs untergebracht ist. Und damit löst sich dann auch das Rätsel um den zweiten Energiespeicher, der unter der Motorhaube nicht zu entdecken ist.
Ein Bild dazu ist hier:
http://www.db-forum.de/showthread.php?s=&postid=88351#post88351
Zuletzt bearbeitet: